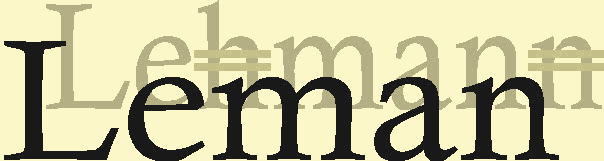|
 |
 |
 |
|
Aus
Lutz Graf Schwerin von Kosigk
„Es geschah in Deutschland“
(Tübingen 1951)
OTTO VON SCHLIEBEN
Schlieben durchlief die übliche Laufbahn des preußischen Verwaltungsbeamten, war ein tüchtiger Landrat gewesen und hatte das Ende des Krieges als Vortragender Rat in der Reichskanzlei erlebt. Er er zählte einmal, welch unauslöschlichen Eindruck es auf ihn gemacht habe, daß historische Entwicklungen durch die ungenaue Wiedergabe einer Nachricht ausschlaggebend beeinflußt werden können. In den schicksalsschweren Novembertagen 1918 teilte die Reichskanzlei dem Großen Hauptquartier in einem Ferngespräch mit, daß in Berlin das erste Blut geflossen sei. Die Nachricht ist dort in der Form weitergegeben worden: » Berlin fließt in Blut. « Dies hat die Entscheidungen, die zu des Kaisers Flucht nach Holland führten, mitbestimmt. Nach dem Kriege wurde Schlieben in die Etatsabteilung des Finanzministeriums versetzt und nach wenigen Jahren zu ihrem Leiter ernannt. In dieser Stellung konnte er seine guten Eigenschaften entfalten: Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und unermüdliche Arbeitskraft. Die Tugenden, die man am alten Beamtentum rühmt, waren in Schlieben vereinigt, doch hatte er überdies noch eine Konzilianz, wie man sie in Preußen seltener traf: neben dem » fortiter in re « das » suaviter in modo «. Er setzte mit zäher Beharrlichkeit seinen Standpunkt in Ressort- und parlamentarischen Ausschußberatungen durch, aber entwaffnete durch seine Ruhe und beschwichtigte durch seine Umgänglichkeit, gelegentlich auch durch ein freundliches Scherzwort. Das Schicksal der Rentenmark hing davon ab, daß das Reich während einer bestimmten Periode mit den ihm zur Verfügung gestellten, sehr geringen Mitteln auskam; es konnte nicht in besseren Händen sein als in denen des Etatdirektors von Schlieben. Von Luthers, seines Ministers, aktiver Energie begleitet und geschützt, kämpfte Schlieben um jeden Pfennig. Gegen Verschwendung von öffentlichen Mitteln und Nachlässigkeit in ihrer Betreuung war er unerbittlich; hier verlangte der sonst so gütige Mann, daß, schon zum abschreckenden Beispiel, jeder Schuldige unnachsichtlich zur Verantwortung gezogen wurde. Seiner in der Stille geleisteten Arbeit kommt ein wesentliches Verdienst daran zu, daß sich die Rentenmark behauptete.
Als Luther Anfang 1925 Reichskanzler wurde, war Schlieben der gegebene Nachfolger als Finanzminister. Er hat sich wesentlich als »Etatminister« gefühlt. In Steuerfragen war er nicht zu Hause. Er wußte sie auch bei dem Staatssekretär Popitz in bester Hut, der wiederum seinen zum Minister avancierten Kollegen als reinen »Etatisten« mit einer Mischung von Hochachtung und Überlegenheit betrachtete. So war denn auch die Steuerreform des Jahres 1925 im wesentlichen das Werk von Popitz. Schlieben hatte auf anderen Gebieten genug zu tun. Politisch stand die » Aufwertung « im Vordergrund. In dieser Frage hat Schlieben manch schweren inneren Kampf zu bestehen gehabt. Es ging ihm gegen das Gefühl, daß der durch die Inflation verarmte und in das Proletarierdasein herabgedrückte wertvolle Mittelstand seiner Sparguthaben, Hypotheken, Wertpapiere, Staatsanleihen beraubt wurde. Er sah voraus, daß die Radikalisierung dieser zur Verzweiflung getriebenen Schicht zu schweren Erschütterungen des Staatslebens führen konnte. Es widerstrebte auch seinem Gerechtigkeitsgefühl, daß die Sachbesitzer im Vergleich zu den Geldbesitzern unverhältnismäßig gut davonkamen und daß der Staat mit einem Federstrich sich seiner drückenden Schuldenlast entledigte. Er fürchtete, daß sich das verletzte Rechtsgefühl einmal gegen den Staat wenden werde. Aber als Hüter der Währung und der Staatsfinanzen sah er keinen anderen Ausweg. Der neue Haushalt durfte nicht von vornherein unter einem Handicap stehen. Durch Bevorzugung der »Altbesitzer« und eine Reihe von Billigkeitsvorschriften suchte er einen sozialen Ausgleich zu erreichen. In der Finanzgeschichte ist sein Name mit der sogenannten Thesaurierung verbunden. Die in den Jahren 1923 und 1924 geübte Sparpolitik und das wieder regelmäßig fließende Steueraufkommen hatten im Etatjahr 1924 einen Überschuß von 500 Millionen erbracht. Schlieben schlug in seinem Haushaltsplan für 1925 vor, sie zur Schaffung eines Betriebsmittelfonds für das Reich zu verwenden. Mit diesem Posten sollte das Kassendefizit, das regelmäßig am Monatsende auftrat, überbrückt werden. Zugleich aber wollte er eine Reserve schaffen, aus der in Krisenzeiten zur Belebung der Wirtschaft staatliche Aufträge erteilt werden konnten. Es war dies der Ansatz für eine staatliche » Konjunkturpolitik«, eine Nachahmung Josefs in Ägypten, der in den fetten Jahren Getreide ansammelte, um es in den mageren zu verteilen.
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Und tatsächlich war Schlieben Josef darin ähnlich, daß er wie ein guter Hausvater die Ersparnisse eines Rechnungsjahres nicht alsbald wieder » aufgegessen « sehen, sondern als Reserve für eine unsichere Zukunft wahren wollte. Dies war für den Finanzminister, aber auch für den Menschen Schlieben charakteristisch. Deshalb kämpfte er mit der ganzen ihm eigenen Zähigkeit gegen alle Widerstände. Und es waren viele Widerstände, die sich, angefangen beim eigenen Staatssekretär, dieser Politik entgegenstellten. Zahlreiche Wirtschaftler und Politiker kritisierten seine »Th esaurierung« als altmodisch, zwar für den Privathaushalt geeignet, aber nicht für die staatliche Finanzpolitik. Schlieben focht es wenig an, daß man in seiner Reservewirtschaft mehr die Hand des früheren Etatdirektors als die eines Ministers zu spüren meinte. Er hat sich auch in seiner Ministerstellung stets als Beamter gefühlt. Sein Auftreten im Parlament litt darunter, daß er kein Redner war. In Konferenzen, Ressortbesprechungen und Ausschußverhandlungen debattierte er schlagfertig, im Plenum war er in einer geradezu schuljungenmäßigen Verlegenheit, wenn er das Wort ergreifen sollte. Von jeher hat es die deutsche Erziehung unterlassen, den jungen Menschen frühzeitig von der Unsicherheit im öffentlichen Auftreten zu befreien. Deshalb war im allgemeinen der Parlamentarier als Minister dem Beamtenminister überlegen. Es gab aber auch Beamtenminister, die von Natur oder durch langjährige Übung gewandte Redner waren. Schlieben gehörte nicht zu ihnen. Seine Reden ließ er sich vorbereiten. Den Entwurf der Etatrede für 1925 übernahm er unverändert, ließ mich aber am Tage vor der Reichstagssitzung rufen und trug mir auch eine Entgegnung zu den vermutlichen Einwendungen der Opposition auf. Ich warnte ihn, einen formulierten Text abzulesen, es würde keinen guten Eindruck machen, wenn er in Erwiderung auf die Angriffe im Parlament die Hornbrille aufsetzte und ein vorbereitetes Papier abläse. Es sei besser für ihn, wenn er frei spreche. Schlieben blieb dabei, ich solle ihm zum nächsten Morgen einen Entwurf ausarbeiten, er fühle sich dann sicherer. Ich ließ ihn in voller Absicht im Stich. Schlieben, der bei aller Freundlichkeit nicht temperamentlos war und gelegentlich erhebliche Zornesausbrüche haben konnte, lief dunkelrot an. Er sagte kein Wort, gönnte mir aber auch keinen Blick mehr. esaurierung« als altmodisch, zwar für den Privathaushalt geeignet, aber nicht für die staatliche Finanzpolitik. Schlieben focht es wenig an, daß man in seiner Reservewirtschaft mehr die Hand des früheren Etatdirektors als die eines Ministers zu spüren meinte. Er hat sich auch in seiner Ministerstellung stets als Beamter gefühlt. Sein Auftreten im Parlament litt darunter, daß er kein Redner war. In Konferenzen, Ressortbesprechungen und Ausschußverhandlungen debattierte er schlagfertig, im Plenum war er in einer geradezu schuljungenmäßigen Verlegenheit, wenn er das Wort ergreifen sollte. Von jeher hat es die deutsche Erziehung unterlassen, den jungen Menschen frühzeitig von der Unsicherheit im öffentlichen Auftreten zu befreien. Deshalb war im allgemeinen der Parlamentarier als Minister dem Beamtenminister überlegen. Es gab aber auch Beamtenminister, die von Natur oder durch langjährige Übung gewandte Redner waren. Schlieben gehörte nicht zu ihnen. Seine Reden ließ er sich vorbereiten. Den Entwurf der Etatrede für 1925 übernahm er unverändert, ließ mich aber am Tage vor der Reichstagssitzung rufen und trug mir auch eine Entgegnung zu den vermutlichen Einwendungen der Opposition auf. Ich warnte ihn, einen formulierten Text abzulesen, es würde keinen guten Eindruck machen, wenn er in Erwiderung auf die Angriffe im Parlament die Hornbrille aufsetzte und ein vorbereitetes Papier abläse. Es sei besser für ihn, wenn er frei spreche. Schlieben blieb dabei, ich solle ihm zum nächsten Morgen einen Entwurf ausarbeiten, er fühle sich dann sicherer. Ich ließ ihn in voller Absicht im Stich. Schlieben, der bei aller Freundlichkeit nicht temperamentlos war und gelegentlich erhebliche Zornesausbrüche haben konnte, lief dunkelrot an. Er sagte kein Wort, gönnte mir aber auch keinen Blick mehr.
Im Reichstag wurde seine nicht gut vorgelesene Etatrede mit schwachem Beifall der Regierungsparteien aufgenommen. In der Diskussion übte die Opposition scharfe Kritik, einzelne Redner überschütteten Schlieben mit Spott und Hohn. Ich sah, wie es in ihm zu kochen begann. Dann sprang er auf und sprach. Er brachte keinen Satz zu Ende, aber die Erregung gab seinen Worten Gewicht. Jeder Torso erntete wachsenden Beifall, und als er sich schwer atmend niedersetzte, belohnte ihn donnernder Applaus. Lächelnd drehte er sich zu mir um und sagte: » Danke Ihnen! « Schlieben gehörte den Deutschnationalen an. Aber er war alles andere als ein eingefleischter Parteimann. Er sprach häufig über die Fehler, welche die Partei in ihrer außenpolitischen und sozialen Haltung nach seiner Ansicht beging. Er fühlte sich in seiner Amtsführung als Fachminister und war unabhängig von Parteieinflüssen. So zögerte er keinen Augenblick, eine Maßnahme, die er pflichtmäßig für richtig hielt, selbst dann durchzuführen, wenn seine Partei dagegen war. Im Kabinett beschränkte er sich auf sein Ressort. In die Aufgaben der übrigen Minister mischte er sich nicht ein. Der Europa -Politik Stresemanns, die nach Locarno führte und von der Rechten leidenschaftlich abgelehnt wurde, stimmte Schlieben aus innerer Überzeugung zu. Er folgte weniger dem hohen Gedankenflug Stresemanns als der nüchternen Überlegung, daß eine Besserung der außenpolitischen Lage Deutschlands nur in mühsamen Etappen zu erreichen sei. In dieser Frage war er grundsätzlich anderer Ansicht als die Deutschnationalen. Als diese aber wegen der Stresemann-Politik sich von Luther trennten und ihre Minister aus dem Kabinett zurückzogen, machte Schlieben nicht geltend, daß er diesem als Fach-, nicht als Parteiminister angehöre. Es war für ihn eine Anstandspflicht, ebenfalls zurückzutreten, obwohl er bei der Frage, die zum Rücktritt führte, auf der Seite des Kabinetts, nicht seiner Partei stand. Auch ein Parteiwechsel aus diesem Grunde wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Er war Konservativer gewesen und deshalb Deutschnationaler geworden. Das blieb er, auch wenn er mit der Partei in manchem nicht einig war. Sein von vielen nicht verstandenes Verhalten in diesem Konflikt paßt in sein Charakterbild. Diesen Mann bestimmte nicht der Ehrgeiz, sondern nur das, was Pflicht und Anstand ihm geboten. |
|